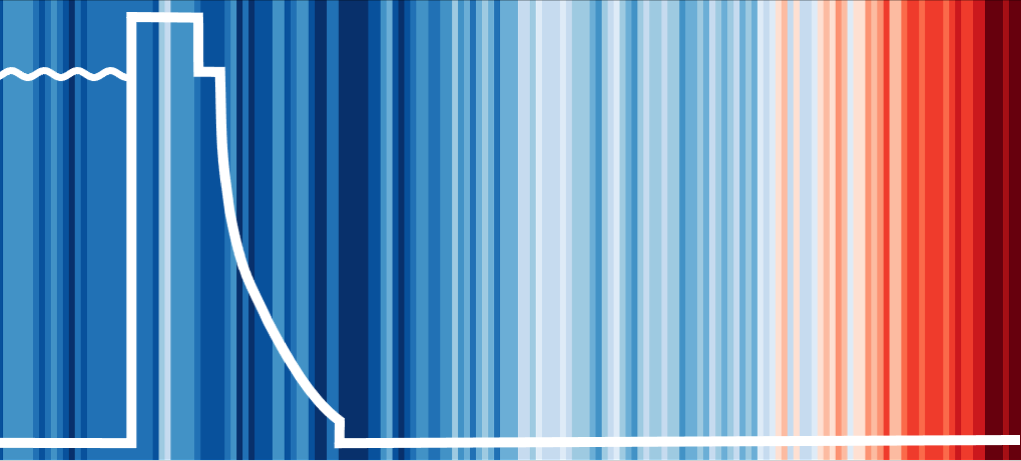Interview mit Installations- und Heizungsbaumeister Finn Matthies Röpke, Laboe
IKL: Herr Röpke, wir freuen uns, dass Sie sich zwischen zwei Kundenterminen Zeit für ein Gespräch zu aktuellen Fragen der zukünftigen Wärmeversorgung in Laboe nehmen. – Was erwarten Sie von dem energetischen Quartierskonzept, das derzeit für das Unterdorf und angrenzende Bereiche erarbeitet wird?
Röpke: Dann wissen wir, in welchen Bereichen ein neu zu verlegendes Wärmenetz wirtschaftlich betrieben werden kann. Die bestehenden Wärmenetze in Laboe mit Temperaturen um 60-70°C halte ich allerdings für energetisch ungünstig, da die Wärmeverluste in der Straße erheblich sind. Die Niedertemperaturnetze (8 bis 13°C) – auch Kaltwärmenetze genannt – haben dagegen geringere Wärmeverluste, sind einfacher zu verlegen und die Rohre sind günstiger. Allerdings ist dann eine Wärmepumpe in dem Haus erforderlich. Ich halte die kommunale Wärmeplanung für ein sehr gutes Instrument – wenn die Ergebnisse der Studie vorliegen, müssen sie in der Gemeindevertretungt diskutiert und Entscheidungen getroffen werden.