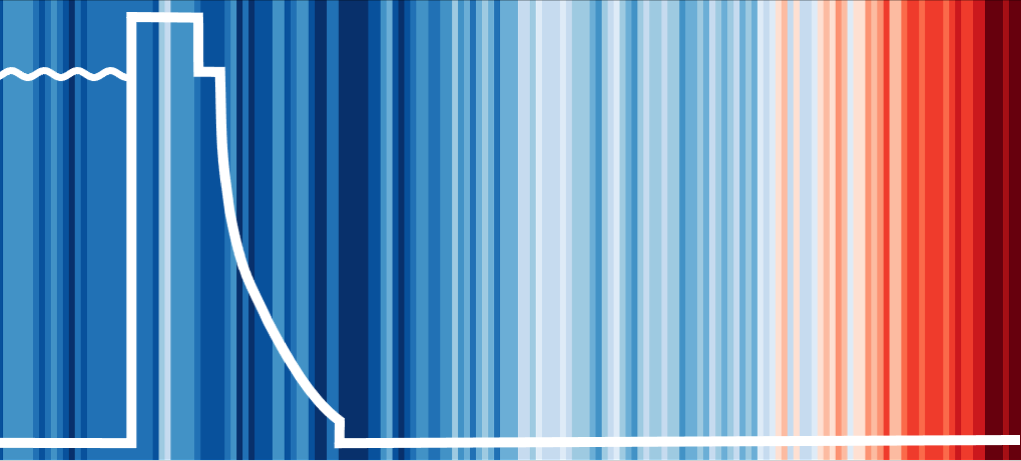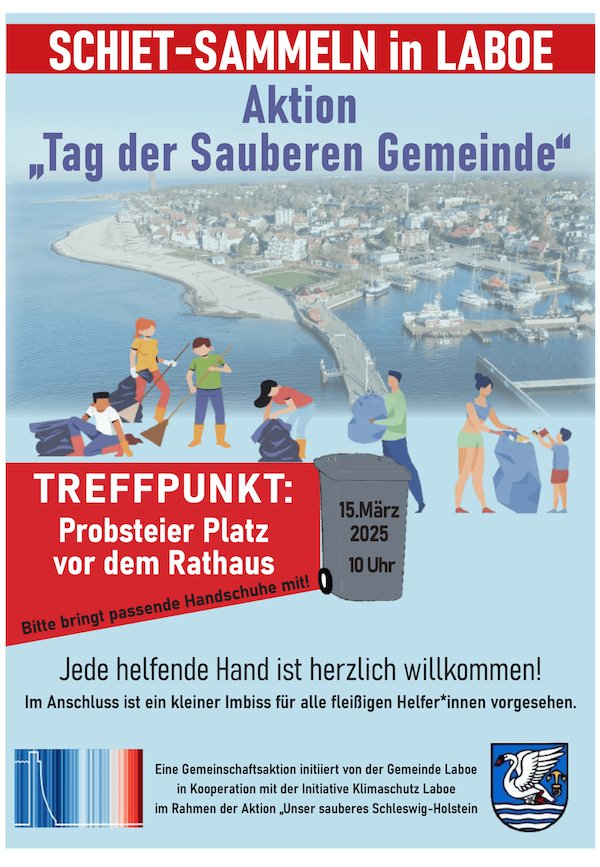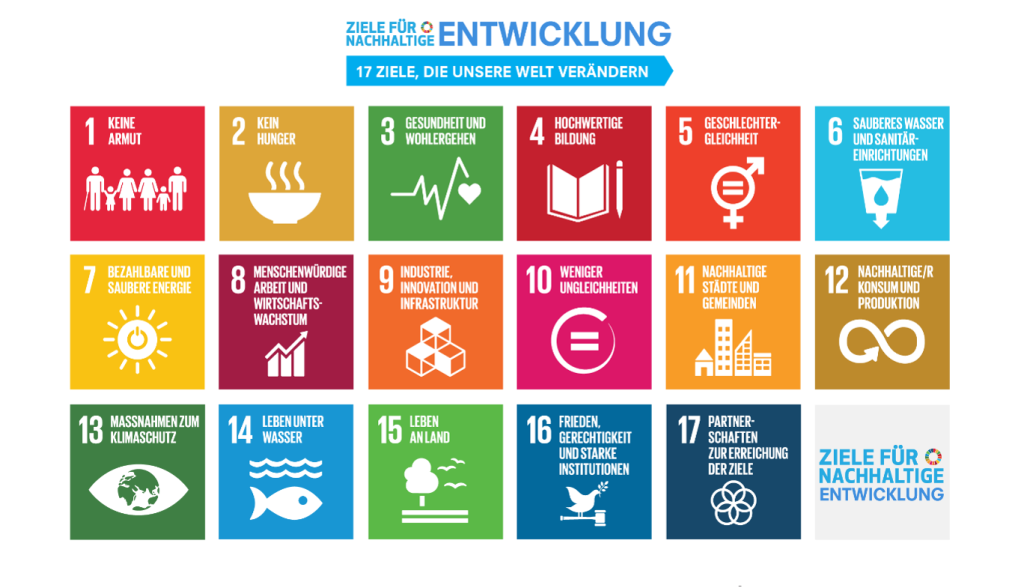Am Freitag, den 11. April 2025 trafen sich 15 MitstreiterInnen der Initiative Klimachutz Laboe (IKL) zu einer Gründungsversammlung um einen Verein zu gründen. Nach drei Jahren als freie Gruppierung führten folgende Überlegungen in der IKL zu der Entscheidung einen Verein zu gründen:
Verantwortung und Aufgabenverteilung: In einer Vereinsstruktur sind die Aufgaben und Verantwortungen wie Vorsitz, stellvertretender Vorsitz, Schriftführung und Kassenwart auf verschiedene Personen verteilt. Die VertreterInnen werden gewählt und legen Rechenschaft gegenüber der Mitgliderversammlung ab.
Einfluss und Mitbestimmung: In einem Verein haben die Mitglieder die Möglichkeit, Entscheidungen mitzugestalten und ihre Stimme einzubringen. Die weitere Entwicklung der IKL kann auf der Grundlage demokratischer Strukturen mitgestaltet werden.